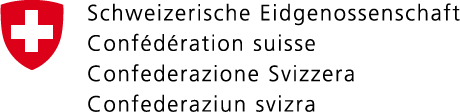Laura Reymond-Joubin: «Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikten, sondern setzt die Schaffung einer lebensfähigen und nachhaltigen Gesellschaft voraus».
Die Sicherheitskrise in der Region der Grossen Seen hat ihr Epizentrum im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK), wo die Menschen seit Ende 2021 unter dem Wiedererstarken der bewaffneten Gruppierung «Bewegung des 23. März» (M23) leiden. Diese komplexe Krise dauert bereits seit mehr als 20 Jahren an und trifft die Bevölkerung hart. Interview mit Laura Reymond-Joubin, die in der Schweizerischen Botschaft in der DRK drei Jahre lang als Beraterin für menschliche Sicherheit im Einsatz war.

Laura Reymond-Joubin kehrte im Sommer 2025 nach einem dreijährigen Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo in die Schweiz zurück. © EDA
Die Region der Grossen Seen ist eine der am dichtesten bevölkerten Regionen Afrikas. Die Menschen in der DRK, in Ruanda, Burundi, Uganda und Tansania sind über die Grenzen hinweg durch Sprache, Kultur, Handel und Familienbande eng miteinander verbunden. Rivalitäten um Land, Macht und Ressourcen führen jedoch zu Spannungen. Die Ursachen dafür liegen in der kolonialen Vergangenheit, in Bürgerkriegen, politischer Instabilität, schlechter Regierungsführung und interethnischen Spannungen, die den gesellschaftlichen und politischen Zusammenhalt zerrüttet, Gewalt ausgelöst und Millionen von zivilen Opfern gefordert haben.
Im Jahr 2025 waren über 21 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Konfliktprävention, Konfliktlösung und nachhaltige Friedenssicherung stehen im Mittelpunkt des Schweizer Engagements für Frieden und Menschenrechte in der Region.
Laura Reymond-Joubin, bitte beschreiben Sie uns Ihre Arbeit als Beraterin für menschliche Sicherheit für die Schweiz in der DRK.
Mein Auftrag lautete, das Schweizer Expertenwissen in den Bereichen Mediation sowie Konfliktprävention und -minderung zu vermitteln. In einem Kontext mit zahlreichen bewaffneten Gruppierungen, die die Sicherheit und die Menschenrechte im Osten der DRK bedrohen, bestand meine Hauptaufgabe darin, den an Friedensprozessen beteiligten Akteuren unser Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Es ging also darum, die Kapazitäten der politischen Akteure sowie der lokalen Organisationen im Hinblick auf nachhaltige und integrative Friedensprozesse zu stärken. So habe ich beispielsweise zur Annäherung der Vermittlerinnen und Vermittler der Friedensprozesse und lokaler Organisationen beigetragen, um eine Demobilisierung bewaffneter Gruppen herbeizuführen. Darüber hinaus konnte die Schweiz für Angola eine Mediationsschulung durchführen, als das Land im Dialog zwischen der DRK und Ruanda vermittelte.

Wie sah Ihre tägliche Arbeit im Feld aus?
Ich habe viele Analysen zu Konfliktursachen und -akteuren durchgeführt, aber auch zu Friedensförderern, um herauszufinden, wie die Schweiz zur Prävention und Reduktion von Gewalt und zur Entwicklung von Dialogprozessen, die zu einem dauerhaften Frieden führen, beitragen kann. Ich hatte täglich zahlreiche Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, z. B. mit Regierungsmitgliedern, Diplomatinnen und Diplomaten, Medienschaffenden sowie Vertreterinnen und Vertretern lokaler und internationaler Organisationen, lokaler Gemeinschaften oder auch des Militärs. Zu diesem Zweck reiste ich regelmässig in den Osten des Landes, insbesondere in die Provinzen Ituri sowie Nord- und Südkivu. Zwischen der Hauptstadt Kinshasa und dem Osten des Kongo liegen mehr als 2000 Kilometer – die Realitäten sind sehr unterschiedlich. Zu den Höhepunkten meines Einsatzes gehörten die Begleitung des damaligen Bundespräsidenten Alain Berset während seiner Reise in die DRK im April 2024, und die Teilnahme als Beobachterin an den kongolesischen Präsidentschaftswahlen im Dezember 2023.
Sie mussten also kontinuierlich das Vertrauen Ihrer Gesprächspartner pflegen...
Ja, es war mir wichtig, allen zuzuhören: Politikerinnen und Politikern, vom Konflikt betroffenen Personen sowie bewaffneten Angreifern. Ich wollte ihre Alltagsrealität verstehen. Bei meinen Kontakten mit Regierungsvertreterinnen und -vertretern machte ich stets darauf aufmerksam, dass es meine Aufgabe war, sie gemäss ihren Bedürfnissen und Prioritäten zu unterstützen. Die Expertise und der gute Ruf der Schweiz machten dabei die Dinge oft leichter. Als Akteure pflegen wir nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Diskretion. Wir werden als aufrichtige und transparente Partner wahrgenommen.
Die Einsatzdauer als Beraterin oder Berater für menschliche Sicherheit beträgt in der Regel ein Jahr und kann verlängert werden. Reicht das aus, um im Feld effektiv etwas zu bewirken?
Mein Einsatz in der DRK dauerte drei Jahre. Der Kontext ist sehr komplex, und es braucht viel Zeit, um Vertrauensbeziehungen aufzubauen und sinnvolle Arbeit zu leisten.

In der Region der Grossen Seen ist die Gewalt gegen Frauen und Mädchen besonders hoch. Seit Beginn der Umsetzung ihres Kooperationsprogramms in der Region setzt sich die Schweiz auch und vor allem für die aktive Beteiligung von Frauen an der Konfliktprävention, an Friedens- aber auch an Aussöhnungsprozessen ein. Welche Bilanz ziehen Sie in dieser Hinsicht aus Ihrer Mission?
Frauen und Mädchen sind als Erste Opfer von Konflikten, aber sie sind auch die Ersten, die aktiv werden, um zum Frieden beizutragen. Ich habe viele Frauen getroffen, die zu den Anführern bewaffneter Gruppen gingen, um den Schutz der Zivilbevölkerung einzufordern. In Ituri zum Beispiel sorgte die Organisation «Femmes en Action pour le Développement Multisectoriel» (FADEM) für Räume des Vertrauens und des Dialogs, in denen sich Mitglieder rivalisierender bewaffneter Gruppen und die Bevölkerung austauschen konnten. Dies trug unmittelbar zum Abbau der Feindseligkeiten, zur Freilassung von Geiseln und zu einem leichteren Zugang für humanitäre Hilfe bei. Dank meinen Kontakten zu diplomatischen Kreisen und zu politischen Entscheidungsträgern konnte ich diesen Akteurinnen und ihren Aktionen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. So arrangierte ich beispielsweise im Rahmen der Vermittlung des angolanischen Präsidenten zwischen der DRK und Ruanda ein Treffen mit 40 Frauen aus der DRK und anderen Ländern der Region. Diese Vernetzung ist wichtig und erlaubt es den Entscheidungsträgern, die Realität der Bevölkerung besser zu verstehen und ihre Anliegen in Friedensprozessen mitzuberücksichtigen.
Die Aufgabe von Beraterinnen und Beratern für humanitäre Sicherheit in Konfliktgebieten besteht vor allem darin, den Dialog zwischen den verschiedenen Schlüsselakteuren vor Ort zu fördern. In dieser Hinsicht ist jeder Dialog ein Dialog für die Menschenrechte. Sehen Sie das auch so?
Meine Arbeit bestand in erster Linie darin, einen Ansatz zu stärken, der als «menschliche Sicherheit» bezeichnet wird. Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen bedeutet auch, sich mit seinen Rechten zu befassen. Fehlt der Rechtsstaat, hat die Gewalt ein leichtes Spiel. Im Rahmen des Friedensförderungsprogramms unterstützten wir die Organisation Trial, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen und Verstössen gegen das Völkerrecht begleitet sowie Richterinnen und Richter in der Beurteilung von Kriegsverbrechen ausbildet. Mit der Bestrafung solcher Verbrechen lassen sich neue, von Rachegelüsten geleitete Zyklen der Gewalt verhindern und somit die Menschenrechte schützen.
Eine Besonderheit der vom Bund in die Region entsandten Beraterinnen und Berater für menschliche Sicherheit ist, dass die Schweiz als zuverlässige, neutrale und unabhängige Partnerin wahrgenommen wird, die für ihre Nähe zum lokalen Geschehen vor Ort, ihren Pragmatismus und ihre Flexibilität bekannt ist. Haben Sie das im Rahmen Ihrer Mission gespürt?
Die Regierung der DRK war stets bestrebt, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme zu finden. Ausländische Personen aus der westlichen Welt können manchmal Misstrauen hervorrufen. Es kann der Verdacht aufkommen, dass unsere Analyse der Situation voreingenommen ist oder dass unsere Handlungen eine versteckte Agenda verfolgen. Andererseits hatten wir unzählige Begegnungen, die ohne das Schweizer Wappen nicht möglich gewesen wären. Die Neutralität der Schweiz signalisiert Transparenz und Fehlen jeglicher versteckten Agenda. Wir haben eine vorteilhafte Position, die jedoch kontinuierlich gepflegt werden muss.

Die UNO-Präsenz in der Region der Grossen Seen ist noch immer stark. Die MONUSCO, zu der die Schweiz mit Polizei-, Militär- und Zivilpersonal beiträgt, ist nach wie vor die grösste Friedensmission der Welt, doch ihr Mandat steht unter Druck. Wird die Rolle der Peacekeeper in der Region Ihrer Meinung nach missverstanden?
Die MONUSCO ist schon sehr lange präsent, aber für ihr Mandat fehlt es noch immer an Verständnis. Denn obwohl sie seit über 20 Jahren im Einsatz ist, dauert der Konflikt noch immer an. Ausserdem entspricht die Mission, was den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten betrifft, nicht ganz den Erwartungen der Bevölkerung. Allerdings spielt diese Mission eine unterstützende Rolle. Sie soll den Staat ergänzen und nicht ersetzen. In Ituri zum Beispiel bekräftigten meine Gesprächspartner oft, dass die MONUSCO die Gewalt eindämmt und die begangenen Übergriffe publik macht. Seit sich die MONUSCO auf Wunsch der Regierung aus Süd-Kivu zurückgezogen hat, ist es sehr schwierig geworden, Zugang zu abgelegenen Gebieten zu erhalten, in denen die Bevölkerung besonders gefährdet ist, und so von möglichen Verstössen Kenntnis zu erlangen.
Sie waren im Januar 2025 zum Zeitpunkt der Verschärfung des Konflikts an der Grenze zu Ruanda. Gilt der Ausbruch einer neuen Krise für eine Beraterin für menschliche Sicherheit, die für die Friedenssicherung zuständig ist, als Niederlage?
Ich war tatsächlich zwei Tage, bevor die M23 in Goma einmarschierte, noch in der Stadt. Der Konflikt dauerte seit drei Jahren und die Situation war bereits angespannt, aber ich hatte nicht erwartet, dass sie sich so drastisch verschlechtern würde. Wenn man sich für die Friedensförderung einsetzt, muss man mit Rückschlägen und Hindernissen rechnen. Vieles des zuvor Erreichten ging im Januar unweigerlich verloren, ich denke dabei vor allem an die Kriegsverbrecher, die aus den Gefängnissen entkamen. Anderes blieb jedoch intakt. Besonders beeindruckend fand ich die Widerstandsfähigkeit der lokalen Gemeinschaften, in denen sich unsere Partner engagieren. Ihre Arbeit zur Schaffung von Räumen für den Dialog hat dazu beigetragen, den sozialen Zusammenhalt trotz Spannungen und zunehmender Hassreden zu bewahren. So gesehen sind die unternommenen Anstrengungen letztlich nie umsonst.